|
Wieviele Sätze lassen sich aus den hier vorgegebenen 2 x 3 = 6 Satzteilen bilden, wenn jeder der resultierenden Sätze zweigliedrig sein, und wenn die Abfolge von links nach rechts gewahrt bleiben soll? Es ist leicht zu sehen, daß folgende Lösungen möglich sind:
Der Saufbruder schläft.
Der Saufbruder geht baden.
Der Saufbruder schwankt.
Homer schläft.
Homer geht baden.
Homer schwankt.
Die Regierung schläft.
Die Regierung geht baden.
Die Regierung schwankt.
Mathematisch ausgedrückt handelt es sich hier um die Permutation der Kombinationen von n Elementen zur r-ten Klasse, wobei in diesem Fall n = 3 und r = 2. Die Anzahl der möglichen Permutationen der Kombinationen (auch Zahl der Variationen genannt) läßt sich wie folgt angeben:
[1]
V’r (n) = nr;
das sind im vorliegenden Fall 32 = 9 Variationen.
Nimmt man statt drei Elementen zehn an, und geht man von zwei- zu sechsgliedrigen Ausdrücken über, so ergeben sich mithin 1o6 Variationen.
1.2.2. Jede dieser Variationen läßt sich als eine Gedichtzeile auffassen, die mit anderen, analog aufgebauten Zeilen als Element für den Aufbau von Variationen höherer Ordnung verwendet werden kann. Werden nun diese Elemente zweiten Grades, jedes von der Konfiguration V’r (n), ihrerseits zur R-ten Superklasse variiert, so ergibt sich hieraus die Permutation der Kombinationen der Permutationen der Kombinationen, oder mit anderen Worten die Variation zweiten Grades:
[2]
V”R V’r (n) = nr .
Tja, und eine solche Variation zweiten Grades ist die mathematische Struktur eben jenes bescheidenen Programms, zu dem hier eingeladen werden soll, und das sich — um sozusagen die Kirche im Dorf zu lassen — mit der deutschen Sprache begnügt. Es enthält nämlich ein Repertoire von zehn mal sechs Gedichtzeilen, deren jede aus sechs Einzelgliedern besteht, mit anderen Worten, aus einem Repertoire von zehn Elementen, die zur sechsten Klasse und zur sechsten Superklasse variiert werden. Das führt zu insgesamt zehn hoch sechs hoch sechs, also 1o36 Variationen.
1.2.3. An diesem Punkt pflegen die Liebhaber der Statistik ihren wehrlosen Zuhörern zu erklären, was eine Zahl mit 36 Nullen bedeutet. Dabei muß meist der Eiffelturm oder der Äquator herhalten; notfalls wird auch die Entfernung der Erde vom Mond zu Hilfe genommen, um das Unermeßliche meßbar zu machen. Solche Erläuterungen sind trivial. Es versteht sich von selbst, daß das Universum 1o36 Gedichte nicht beherbergen kann. Zahlen dieser Größenordnung sind nicht nur unvorstellbar, sie sind abscheulich.
1.3. Weichware
1.3.1. Der Poesie-Automat ist einerseits ein abstraktes Modell, dessen Struktur dem Regelsystem Grammatik/Poetik folgt, andererseits eine konkrete Maschine, die nach den üblichen Regeln der Technik gebaut werden kann. Gerät und Programm, Hardware und Software müssen zwar aufeinander abgestimmt sein, lassen sich aber unabhängig voneinander beschreiben.
1.3.2. Der Bau der Maschine ist relativ simpel, aber das Programm ist vertrackt. Es muß eine Unzahl von formalen und inhaltlichen Bedingungen erfüllen, die derart ineinander verzahnt sind, daß sich keine von ihnen herauslösen läßt. Die grundsätzliche Schwierigkeit bei seinem Aufbau liegt darin, daß dieser Prozeß nicht formalisierbar ist: ein Programm des Programms existiert nicht. Exakt bestimmbar ist nur seine Hohlform, das leere kombinatorische Gerüst.
1.3.3. Die Eigenschaften dieser mathematischen Matrix sind bereits beschrieben worden.” Ein solcher Satz ist eindimensional in dem Sinn, daß er nur in einer Richtung und auf eine Art gelesen werden kann. Anders der Saufbruder:
Der Saufbruder schläft.
Homer geht baden.
Die Regierung schwankt.
Was hier vorliegt, ist ein zweidimensionaler Text, der sich nicht mehr linear abbilden läßt. Die Lektüre kann in zwei Richtungen fortschreiten. Es handelt sich um eine Textfläche. Noch ein Schritt weiter auf diesem Weg, und man hat einen Textkörper vor sich, der Lektüreschritte in drei Dimensionen erlaubt. Aus der vorgegebenen Matrix folgt, daß das Programm des Poesie-Automaten ein dreidimensionales Gedicht sein muß. Leider liefert die Literaturgeschichte kein Beispiel für ein solches Gebilde. Das hängt vielleicht mit dem Umstand zusammen, daß dreidimensionale Texte verdammt schwer zu schreiben sind.
1.3.4. Wer es dennoch versucht, muß bedenken, daß die erste Dimension (rechts/links) allen andern gegenüber insofern privilegiert ist, als sie weder Umkehrungen noch Nullschritte zuläßt. Diese Regel verhindert, daß, beispielsweise, die vorhin zitierte Textfläche ungrammatische Sätze wie die folgenden erzeugt:
Der Saufbruder die Regierung.
Geht baden Homer.
Es folgt daraus, daß die Lektüre nicht beliebig hin- und herspringen kann, sondern an gewisse Regelmäßigkeiten gebunden ist. Diese Einschränkung wird nur der Vollständigkeit halber erwähnt; wir lernen je schon im zarten Alter, sie zu beachten.
1.3.5. Viel heikler ist eine andere Forderung an das Programm, und zwar diese: Alle Textglieder, die aufeinander folgen können, müssen miteinander kompatibel sein. Die folgende Textfläche würde gegen dieses Gebot verstoßen:
Das Haus schläft.
Homer geht baden.
Die Regierungen löffelt.
1.3.6. Die naheliegende (und ausgesprochen heimtückische) Frage lautet nun: Welche Kriterien sollen für die Vereinbarkeit von Textgliedern gelten?
Zwar stellt die Syntax gewisse Minimalbedingungen bereit, die jeder Satz erfüllen muß, wenn er überhaupt als (deutscher, englischer usw.) Satz verstanden werden soll. Ein Satz wie Die Regierungen schläft ist schlicht und einfach falsch.
Anders steht es mit den semantischen Bedingungen, denen ein “einwandfreier” Satz genügen muß. Wie irreguläre, defekte, “unwahrscheinliche” und “sinnlose” Sätze voneinander abzugrenzen sind, das ist auch unter Sprachphilosophen und Linguisten strittig.
Das Haus schläft.
Das Haus löffelt.
Die beiden Sätze sind ganz ähnlich gebaut. Während aber im ersten Fall der Sprachgebrauch die metaphorische Bedeutung von “schläft” anerkannt hat, wird im zweiten Fall die Verbindung der beiden Satzglieder als anomal empfunden.
Die Regel, daß alle aufeinander folgenden Satzelemente miteinander vereinbar sein müssen, gehört also zu den Operationsbedingungen, die sich nicht exakt definieren lassen. Es bleibt eine breite Grauzone strittiger Fälle übrig. Das Programm muß sich mit einer Näherungslösung begnügen.
1.3.7. Ein Automat, der lediglich eine Menge von einwandfrei gebauten Sätzen liefern würde, wäre ziemlich leicht zu konstruieren. Er könnte als heuristisches Modell bei der Beantwortung von linguistischen Fragen dienen. Wer jedoch auf solche Untersuchungen nicht neugierig ist, den würden seine Erzeugnisse nur anöden.
Für ein Gedicht-Programm reichen die kombinatorischen, syntaktischen und semantischen Regeln nicht aus. Sie müssen durch eine poetische Sekundärstruktur moduliert werden.
Nun ist aber die Poetik bekanntlich ein Regelsystem vorwissenschaftlicher Natur. Die Literaturtheorie hat sich jahrhundertelang vergeblich bemüht, daran etwas zu ändern. Das bedeutet, daß eine exakte Beschreibung des Poetik-Programms schon aus methodischen Gründen nicht möglich ist. Man könnte allenfalls, Schritt für Schritt, erzählen, wie es zustande gekommen ist. Das wäre freilich ziemlich langweilig.
1.3.8. Stattdessen sollen abschließend zwei Grundprobleme erörtert werden, die jedes poetologische Programm aufwirft.
Die Regel, daß alle aufeinanderfolgenden Textglieder miteinander vereinbar sein müssen, läßt sich umso leichter erfüllen, je ähnlicher diese Glieder sind. Man braucht sich nur auf möglichst synonyme Ausdrücke zu beschränken, die sämtlich in ihren wörtlichen, unmittelbaren (also nicht übertragenen oder idiomatischen) Bedeutungen fungieren, und sie zu streng parallel gebauten Sätzen zusammenzufügen — und schon hat man ein Programm, dessen Glieder kompatibel sind. Allerdings wäre das Resultat einfältig.
Ein grundlegendes, wenn auch selten formuliertes, weil selbstverständliches Prinzip der Poetik ist jedoch die Mannigfaltigkeit. Vollkommen monotone ästhetische Produktionen sind unerträglich. Das gilt sogar für extrem repetitive “Texte” wie die minimal music; ihre endlosen Wiederholungen werden nur durch unmerkliche, aber bewußt eingesetzte Abweichungen gerechtfertigt.
1.3.9. Zweitens gilt für jede Poetik, daß sie es darauf abgesehen hat, die Regeln der primären Sprachstruktur zu unterlaufen und zu überschreiten. Eine solche Strategie der kontrollierten Regelverletzung liegt auch der Metaphernbildung zugrunde. So verstößt der Satz
Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen
(Lichtenstein) gegen die semantischen Regeln (und erweitert sie zugleich). Dieses Prinzip der gezielten Abweichung greift auch auf die Syntax über.
Während also die Logik einfacher Textautomaten auf Gleichförmigkeit, Regelmäßigkeit, Redundanz und Monotonie zielt, muß ein Poesie-Automat ein Maximum an Mannigfaltigkeit, Überraschung, Polysemie und begrenzter Regelverletzung anstreben. Insofern steht die primäre Struktur des Programms im Gegensatz zu seiner poetischen Sekundärstruktur. Das Ergebnis kann nur ein Kompromiß sein, der beide Seiten dieser Dialektik im Sinn behält.
1.4. Hartware
1.4.1. Man kann mit Kanonen auf Spatzen zielen. Auch auf diese Weise werden Treffer erzielt. Der Umgang von Künstlern mit dem Computer erinnert nicht selten an dieses Verfahren. Fast immer wird mit überdimensionierten technischen Mitteln gearbeitet.
Ein kombinatorischer Poesie-Automat läßt sich, was die Hardware angeht, mit ziemlich einfachen Mitteln realisieren. Elektromechanische Anzeigetafeln, wie man sie auf jedem Flughafen findet, reichen vollkommen aus.
1.4.2. Die alphanumerischen Zeichen erscheinen bei einem solchen System auf einzelnen Paletten, die individuell durch einen Schrittmotor angetrieben werden. Dieser Motor fächert die Paletten derart auf, daß sie nach vorne fallen. Bei jedem Einzelschritt erscheint ein anderes Zeichen. Eine elektronische Steuerung gibt den Motoren die notwendigen Impulse. Sie enthält einen Zufallsgenerator, der aus den verfügbaren Textgliedern eine aleatorische Variation ansteuert. Nach maximal vier Sekunden erscheint auf der Anzeigetafel ein vollständiges Gedicht.
Der Automat kann mehrere voneinander unabhängige Einzelprogramme aufnehmen. Soweit sie die lateinische Schrift verwenden, sind auch Programme in anderen Sprachen möglich.
1.5. Gebrauchsanweisung
1.5.1. Im bürgerlichen Zeitalter galt die Lektüre von Gedichten als eine streng individuelle, private, intime Tätigkeit. Das war nicht immer so und muß nicht immer so bleiben. Die Momente der “Stimmung”, der Introversion, der Versenkung, die zu einer solchen Praxis gehören, sind nicht mehr selbstverständlich.
Ein Poesie-Automat paßt eher in öffentliche Räume, die eine kollektive, zerstreute, anonyme Lektüre erlauben. Er verträgt gewissermaßen keinen Eigentümer. Schon von seiner Kapazität her wäre es absurd, ihn an einem Ort aufzustellen, wo er nur einem Einzelnen zugänglich wäre.
Sein idealer Platz wäre daher ein Zentrum der allgemeinen Zirkulation. Dem entspricht auch seine technische Gestalt, die sich an den Bedürfnissen des Massenverkehrs orientiert. Ein angemessener Ort wäre zum Beispiel die Passagierzone eines großen Flughafens.
1.5.2. In den Abfertigungs- und Wartehallen eines Airports verfügt jedermann über ein gewisses Quantum an leerer Zeit. Die Spanne zwischen Check-in und Abflug erfordert Aufmerksamkeit und zugleich Passivität. Es entsteht eine eigentümliche Atmosphäre, in der sich Ungeduld mit Langeweile und Nervosität mit Ablenkbarkeit mischen. Diese Bedingungen sind günstig für Spiele, die nur kurzfristige Aufmerksamkeit verlangen.
“Die Rezeption in der Zerstreuung, die sich mit wachsendem Nachdruck auf allen Gebieten der Kunst bemerkbar macht und das Symptom von tiefgreifenden Veränderungen der Apperzeption ist” (4), würde sich in einer solchen Umgebung von selbst einstellen.
Da der Automat grundsätzlich für mehrere Sprachen ausgelegt ist, trägt er auch den Bedürfnissen eines polyglotten Publikums Rechnung. Es ist im übrigen nicht einzusehen, warum Großflughäfen wie Rhein-Main oder Heathrow zwar allen denkbaren kommerziellen Interessen entgegenkommen, sich aber, was ihre ästhetischen Standards betrifft, Luftschutzbunker und Kernkraftwerke zum Vorbild nehmen.
Natürlich könnten auch andere Orte, wie Theater- oder Kino-Foyers, ihre Kundschaft mit Gedichten aus dem Automaten erfreuen, ganz zu schweigen von den palmengeschmückten Einöden jener Einkaufs- und Erlebnis-Zentren, die unsere Innenstädte durchlöchern. Daß die Investoren auf eine derartige Idee verfielen, ist allerdings kaum anzunehmen.
1.5.3. Der Poesie-Automat verursacht praktisch keine Betriebskosten. Die Lebenserwartung des Geräts liegt nach Angaben der Hersteller bei etwa fünfzig Jahren. Die Anlage ist wartungsfrei. Bei einem Benutzungsintervall von fünf Minuten wird die durchschnittliche Zeit, die zwischen zwei Betriebsstörungen vergeht, mit zehn Jahren angegeben. Im Literaturbetrieb sind solche Spezifikationen eher selten.
2. Theorie
2.1. Historische Gesichtspunkte
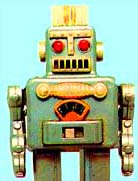 2.1.1. Jede Erfindung beruht auf einer früheren. Auch der Poesie-Automat hat seine Vorgänger. Er zieht die Konsequenz aus einer europäischen Tradition, die sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen läßt.
2.1.1. Jede Erfindung beruht auf einer früheren. Auch der Poesie-Automat hat seine Vorgänger. Er zieht die Konsequenz aus einer europäischen Tradition, die sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen läßt.
Gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts verfaßte der katalanische Scholastiker Ramón Llull (1232–1316) einen Traktat mit dem Titel Ars magna et ultima, in dem er behauptet, die Vielfalt dessen, was existiere, könne auf eine verhältnismäßig geringe Zahl von Grundelementen zurückgeführt werden. Er unterscheidet beispielsweise neun principia absoluta und ebensoviele principia relativa, die er mit symbolischen Buchstaben codiert. Diese Elemente gelten im System des Lullus sozusagen als das Lexikon, aus dem sich, nach einem kombinatorischen Verfahren, unbegrenzt viele Sätze” bilden lassen; da der Philosoph zwischen Signifikant und Signifikat nicht unterscheidet, wirft das Programm zugleich mit den Sätzen das aus, was sie bezeichnen, also mit aller Wissenschaft vom Seienden zugleich alles Seiende. Mit dem philosophischen Gehalt dieser Lehre, die sich ihrerseits aus antiken Quellen, vor allem aus dem Neuplatonismus speist, mögen andere wuchern. Ihr methodischer Kern ist, unabhängig von seiner theologisch-spekulativen Einkleidung, durchaus rational. Lullus spielt sogar in der Geschichte der Automaten eine Rolle. Er soll eine Art logischen Roboter konstruiert haben, der drehbare Kreise, Dreiecke und Zylinder enthielt und Schlußfolgerungen zog (5).
2.1.2. Jedenfalls hat die Ars magna den Grund gelegt sowohl für die modernen Logik-Kalküle wie auch für die kombinatorische Poetik. Beide Entwicklungen lassen sich fast lückenlos durch die Jahrhunderte verfolgen. Der mathematische Zweig dieser Überlieferung reicht über Leibniz (“Alphabet der menschlichen Gedanken”), Boole (Boolsche Algebra), Babbage (Analysis-Maschine) bis zu Peano, Russell, Turing und von Neumann.
Auf der Seite der ästhetischen Kombinatorik wären vor allem Athanasius Kircher (Ars magna sciendi sive combinatoria), Quirinus Kuhlmann, Novalis (mit den Fragmenten) und Mallarmé (mit seinem Projekt des Livre universel) zu nennen.
2.1.3. Die unmittelbare Vorstufe zu dem hier beschriebenen Programm hat Raymond Queneau entworfen. (6) Es handelt sich dabei um einen zweidimensionalen Text. In einem pseudonymen Vorwort zu dieser Schrift beruft sich Queneau auf alte manieristische Traditionen:
“Schon im siebzehnten Jahrhundert hat Georg Philipp Harsdörffer, in einem Anhang, den er den Deliciae physico-mathematicae seines Landsmanns Daniel Schwenter beigab, zum ersten Mal von der Möglichkeit ‘proteischer Gedichte’ gesprochen. Er schlägt vor, innerhalb eines Verses einsilbige Schlüsselwörter zu permutieren — einsilbig deshalb, damit der Sinn sich ändern kann, ohne das Metrum zu zerstören. Durch Permutation der elf Einsilbler, die in den folgenden beiden Versen unterstrichen sind:
Ehr, Kunst, Geld, Guth, Lob, Waib und Kind,
Man hat, sucht, fehlt, hofft, und verschwind.
lassen sich 39 917 8oo verschiedene Distichen gewinnen. (7)
2.1.4. Queneau geht über Harsdörffers Programm hinaus. Er unterwirft nicht einzelne Wörter, sondern ganze Verszeilen einem kombinatorischen Verfahren. Außerdem geht er von der einfachen Permutation zur Permutation der Kombination, d.h. zur Variation über. In seinem zweidimensionalen Automaten werden zehn Elemente zur vierzehnten Klasse variiert, wodurch sich nach [1] 1o14 mögliche Texte ergeben.
Die metrische Struktur, die Queneau gewählt hat, ist die des Sonetts; aus diesem Grunde operiert er mit einem vierzehnzeiligen Schema. Es sind je zehn verschiedene erste, zweite usw. bis vierzehnte Zeilen vorhanden. Jede Zeile läßt sich wie eine Buchseite einzeln umblättern, wodurch alle Textvarianten einzeln ablesbar werden. Damit ist der Autor an die äußerste Grenze dessen vorgestoßen, was die Buchform leisten kann. Dreidimensionale Programme, welche die Variation zweiten Grades ermöglichen, sind auf diese Weise nicht mehr darstellbar.
2.2. Linguistische Gesichtspunkte
2.2.1. Die syntaktischen Regeln, die darüber entscheiden, ob zwei oder mehr Satzglieder miteinander kombinierbar sind, kennt jeder: zum Beispiel die Regeln über die Kongruenz von Substantiv und attributiv gebrauchtem Adjektiv, über die Flexion und die Rektion der Verben. Diese Paradigmen lassen sich formalisieren, und sie sind von der Bedeutungsebene unabhängig.
Weniger eindeutig sind die semantischen Regeln. Die Frage, welche Textglieder miteinander vereinbar sind, läßt sich in vielen Fällen gar nicht mit den Mitteln der Grammatik entscheiden. Oft wirft sie sprachphilosophische Probleme auf, und letzten Endes läßt sie sich wohl nur pragmatisch beantworten. Das ist eine der Schwierigkeiten, an denen die Programmierung von einwandfrei arbeitenden Übersetzungsautomaten bisher gescheitert ist.
2.2.2. Besonders kraß zeigt sich diese Problematik an den sogenannten Partikeln. Die traditionelle Grammatik faßt unter diesem Portemanteau-Begriff eine ziemlich buntscheckige Gruppe von Wörtern zusammen, deren Erforschung lange vernachlässigt worden ist, vielleicht, weil sie so unscheinbar daherkommen. (Ähnliches gilt für manche Adverbialbestimmungen, die sich aus mehreren Wörtern zusammensetzen.) Die interessantesten Partikel sind die Adverbien und Konjunktionen. Sie sind derart widerspenstig, daß sie beim Aufbau des Programms immer wieder für Schwierigkeiten und Überraschungen gesorgt haben. Ein Wort aus dieser Klasse kann Bedeutung und Tonfall eines Satzes schlagartig verändern. Der Effekt ist deshalb so frappierend, weil er sich kaum vorhersehen läßt. Des semantische Potential der Partikel ist also bedeutend, doch die zugrundeliegenden Vereinbarungsregeln sind so gut wie unbekannt.
Die folgende simple Matrix zeigt an einem kleinen Ausschnitt, was es mit diesen Störenfrieden auf sich hat:
Plötzlich nur.
Zwar noch.
Vorläufig erst.
Neuerdings auch.
Gelegentlich sterbe ich ganz.
Inzwischen ja.
Eigentlich schon.
Allerdings aber.
Trotzdem nämlich.
Ansonsten immer.
Nicht alle der hundert möglichen Variationen sind “einwandfrei”, “richtig” oder “sinnvoll” (was immer das heißen mag). Die Gründe, aus denen manche Sätze, welche die Matrix liefert, abgelehnt werden können, sind jedoch verschieden.
Neuerdings sterbe ich immer ist eine Aussage, die schon aus logischen Gründen angezweifelt werden kann. Wenn man unbedingt will, kann man ihr jedoch eine metaphorische Bedeutung beimessen, ähnlich wie in dem folgenden Satz, dessen erstes Adverb anzudeuten scheint, daß er nicht buchstäblich verstanden werden will:
Eigentlich sterbe ich immer.
Anders verhält es sich bei der folgenden Variation:
Allerdings sterbe ich aber.
Das geht nicht. Hier stört die logische Redundanz. In der doppelten Einschränkung steckt ein Rest von doppelter Negation. Aber das reicht nicht aus, um dem Satz zu einer festen Bedeutung zu verhelfen. Es bleibt nur ein schlingernder Eindruck zurück. Manifest widersprüchlich wäre die Behauptung:
Gelegentlich sterbe ich immer.
Neben diesen relativ übersichtlichen Fällen gibt es aber eine beträchtliche Zahl von Sätzen, die in einer semantischen Grauzone liegen. Sie wirken irritierend, ohne daß sich angeben ließe, warum sie eigentlich “falsch” sind:
Plötzlich sterbe ich erst.
Zwar sterbe ich ganz.
Inzwischen sterbe ich noch.
Vorläufig sterbe ich schon.
Die unvorstellbare Komplexität der Regeln, die für die “richtige” Verwendung der Partikeln sorgen, läßt sich jedoch erst ermessen, wenn man dazu übergeht, auch das mittlere Glied der Matrix, also das Verbum, zu variieren. Wenn man nämlich den Ausdruck “sterbe ich” & gegen andere, syntaktisch gleichwertige Ausdrücke austauscht, so hat das buchstäblich unabsehbare Folgen. Ein Satz, welcher der semantischen Grauzone zuzurechnen war, kann durch eine solche Operation regulär werden:
Vorläufig sterbe ich noch.
Vorläufig warte ich noch.
Umgekehrt kann ein normaler Satz durch diesen Tausch ins Zwielicht gerückt werden:
Plötzlich sterbe ich nämlich.
Plötzlich warte ich nämlich.
Mit diesen Andeutungen soll nicht den Linguisten unter die Arme gegriffen werden, die es ohnehin besser wissen. Sie sollen lediglich die Schwierigkeiten zeigen, die mit der Programmierung eines Poesie-Automaten verbunden sind.
2.2.3. Wir glauben heute — Noam Chomsky sei Dank -, daß es ein System von formalen Universalien gibt, das allen natürlichen Sprachen gemeinsam ist. Wenn das wahr ist, müßte auch ein universeller Poesie-Automat möglich sein. Allerdings folgt aus dieser Prämisse nicht, daß sich die nötigen Programme durch Übersetzung gewinnen ließen. Denn universell, im Sinn der Hypothese, ist nur die (unsichtbare) Tiefenstruktur dieser Sprachen, nicht ihre manifeste Grammatik. Unabhängig davon, wie man ihre Unterschiede klassifiziert — darüber besteht keine Einigkeit -, fest steht jedenfalls, daß jede Sprache zum Aufbau ihrer Sätze ihre spezifischen “Beziehungsmittel” verwendet. Für die Programmierung eines kombinatorischen Automaten sind aber gerade diese Mittel wichtig. Allgemein kann man vielleicht sagen, daß Sprachen vom isolierenden und agglutinierenden Typus leichter zu programmieren sind als Sprachen mit polysynthetischen und flektierenden Grammatiken. Ein deutsches Programm ist deshalb schwerer zu schreiben als ein englisches.
2.2.4. Ein Sonderfall sind Sprachen, in denen sich die Schrift unabhängig von der Aussprache entwickelt hat. Das ist vor allem beim Chinesischen der Fall. Ein Poesie-Automat, der nur die Schriftform anzeigt, wäre für eine solche Sprache ganz anders zu entwickeln als nach den hier entwickelten Prinzipien, und auch die Hardware könnte nicht mit alphanumerischen Zeichen arbeiten.
2.3. Literarische Gesichtspunkte
2.3.1. Was die literarische Konfiguration des Automaten angeht, so lassen sich zwei extreme Lösungen denken.
Es ist ziemlich einfach, ein Programm zu entwerfen, das (innerhalb der Grenzen syntaktischer Regeln) möglichst unwahrscheinliche Texte erzeugt. Dabei wird die Entropie minimiert, und es gilt der Satz: Je bizarrer die Verknüpfungen, desto besser. Es entstehen Gedichte, die der Nonsense-Poesie nahestehen.
Dieser Effekt wird jedoch mit einem hohen Grad von Beliebigkeit erkauft. Alles Mögliche tritt mit allem Möglichen in Beziehung. Die Variation ist von hoher Mannigfaltigkeit, wirkt aber irrelevant und ermüdend. Ein historisches Beispiel dafür gibt die écriture automatique der Surrealisten ab.
Auch Queneaus zweidimensionaler Textautomat strebt solche Wirkungen an. Dieser Autor stand anfangs den Surrealisten nahe, doch hat er später Züge eines sekundären Klassizismus entwickelt, die sich auch in der Struktur seines Programms zeigen. Das führt zu einem ironischen Kontrast zwischen dem strikten Traditionalismus der Form (dem Sonett-Schema) und der Willkür der “Aussagen”, die das Niveau des unstrukturierten Blödsinns kaum überschreiten.
2.3.2. Im andern Extremfall wird genau umgekehrt verfahren. Das Programm soll möglichst wahrscheinliche Texte liefern. Die Ergebnisse zeichnen sich durch hohe Regelmäßigkeit und Redundanz aus; die Entropie wird maximiert. Es entstehen kontrastarme, reduzierte Texte, deren ästhetischer Lakonismus durch Verarmung erkauft wird. In der neueren Literatur ist diese Lösung durch die konkrete Poesie vertreten. Ein beliebiges Beispiel:
undundundundundund
undundundundundund
undundundundundund
undundundundundund
undundundundundund
undundundundundund
undundundundundund
undundundundundund
undundundundundund
zerbrechen (8)
2.3.3. Das für den Automaten gewählte Programm strebt keine dieser Lösungen an. Es soll im Gegenteil die Dialektik von Absicht und Zufall, Regelsystem und Aleatorik, Monotonie und Mannigfaltigkeit so weit wie möglich entfalten.
2.3.4. Eine vollständige Beschreibung der Poetik, die dem Programm zugrunde liegt, ist unmöglich. Eine ausführliche Darstellung ihrer Entwicklungsschritte wäre langweilig. Ein paar Faustregeln lassen sich immerhin angeben.
Das Lexikon war so zu wählen, daß es nur zu gezielten, nicht aber zu unbeabsichtigten Wiederholungen kommen kann. Das Material muß ein Minimum von Kohärenz aufweisen, aber zugleich semantisch und pragmatisch so disparat sein, daß auch unvorhergesehene Aussagen zustandekommen. Je mehr latente Polysemien es enthält, desto besser.
Die syntaktische Variabilität ist im Deutschen eng begrenzt. Daran ist vor allem der Flexionsreichtum der Sprache schuld. Hinzu kommen die Vorschriften, die die Satzstellung regeln, und andere Einschränkungen der Freizügigkeit. Das Programm greift deshalb auf stilistische Mittel wie die Aufzählung und die Interjektion zurück. Der Tonfall der Sätze wird durch Partikel und Zeichensetzung beeinflußt und variiert.
Weitere Einschränkungen ergeben sich aus metrischen Gründen. Das Programm soll an kein festes Versmaß gebunden sein. Doch unterliegen auch unregelmäßige Rhythmen gewissen Regeln, was die Abfolge von betonten und unbetonten, schweren und leichten Silben angeht.
Schließlich muß jeder poetische Text auch ein Minimum von kompositorischen Forderungen respektieren. Die bloße Addition von einzelnen Textgliedern oder Zeilen ergibt noch kein Gedicht. Der vollständige Text, wie er auf der Anzeigetafel erscheint, muß “Anfang” und “Ende” haben und eine Art von Fortgang zeigen. Er muß, mit einem Wort, mehr sein als die Summe seiner Teile.
Das ist leicht gesagt, aber schwer zu machen. Denn die genannten Bedingungen sollen ja nicht nur jeweils für sich selber, sondern alle miteinander gelten, und niemand kann im Voraus sagen, welche Folgen es hat, wenn sie sich überlagern. Nur eines wird sich mit Gewißheit sagen lassen: nur ein Dichter wird den Automaten programmieren können.
2.3.5. Dabei taucht eine interessante Frage auf. Weiß ein solcher Dichter, was er tut? Ist er überhaupt imstande, vorherzusehen, was bei seiner Arbeit herauskommt? Die Antwort kann nicht davon abhängen, ob er sein Metier beherrscht, ob er Talent hat oder nicht, usw. Denn wie hoch auch immer er die Kapazität seines eigenen Gehirns einschätzen mag, fest steht, daß sie jedenfalls weit hinter der hier geforderten von der Größenordnung 1o36 zurückbleibt.
Deshalb wird der Autor des Programms sein blaues Wunder erleben, sobald seine Kreatur anfängt, Gedichte zu produzieren. Daß dabei krasse Niveauschwankungen auftreten werden, ist noch das Mindeste. Ganz gleich, nach welchen Kriterien man ihre Qualität beurteilt — es werden sicherlich bald “schlechtere”, bald “bessere” Texte zum Vorschein kommen. Je konsistenter das Programm, desto geringer werden diese Schwankungen ausfallen. Umgekehrt: interessante Gedichte wird vermutlich nur ein Programm liefern, das möglichst viele Freiheitsgrade zuläßt; das hat aber auch zur Folge, daß die überwiegende Mehrzahl eher mittelmäßig, wenn nicht miserabel ausfällt — eine statistische Verteilung, die aus dem “wirklichen” literarischen Leben wohlbekannt ist, und gegen die auch der beste Automat nichts ausrichten kann.
2.3.6. Daß das hier vorgeschlagene Projekt die törichte Frage aufwirft, wer der bessere Dichter sei, “der Mensch” oder “die Maschine”, wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Es ist auch mit der Erkundigung zu rechnen, ob der Automat dazu gedacht ist, den Tod der Kunst, der Literatur, der Poesie usw. herbeizuführen. Glücklicherweise handelt es sich um Tätigkeiten, die nicht durch Tarifabkommen geregelt sind; andernfalls wären Proteste gegen die drohende Vernichtung von Arbeitsplätzen zu erwarten.
Auf die üblichen kulturkritischen Einwände könnte der Autor des Programms nur mit den üblichen Gegenargumenten antworten, etwa mit der Feststellung, daß eine gewerbliche Heimarbeit, deren Erzeugnisse gegenüber denen eines Automaten ins Hintertreffen geraten, überflüssig ist.
Insofern kann der Poesie-Automat auch als kritische Meßlatte dienen. (9) Wer nicht besser dichten kann als die Maschine, der täte besser daran, es bleiben zu lassen.
2.4. Medientheoretische Gesichtspunkte
2.4.1. “Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre” [“A proposition emanating from myself — if variously quoted to my praise or blame — I lay claim to it together with those which will throng here — asserts in a succinct manner that everything in the world exists in order to end in a book.” — Stéphane Mallarmé, ‘The Book, Spiritual Instrument’]
Mit diesem berühmten Satz Mallarmés erreicht der Fetischismus, den die europäische Kultur mit dem Buch getrieben hat, seinen Höhepunkt. Mallarmé hat allen Ernstes den Plan verfolgt, ein Buch zu schreiben, in dem die gesamte Poesie enthalten wäre — ein Ziel, das sich am besten auf englisch wiedergeben läßt: A book to end all books.
Er griff zu diesem Ende auf die Ideen des Ramón Llull und seiner Schüler zurück. In seinen Notizbüchern findet sich die Zahl 3 628 8oo. Das ist der numerische Ausdruck für die Fakultät von 1o, und n! gibt bekanntlich die Zahl der möglichen Permutationen von n an. Obgleich er die Absicht hatte, seine Ergebnisse kritisch zu sichten und unter den kombinatorisch erzeugten Texten eine Auswahl zu treffen, rechnete Mallarmé für sein Projekt mit einem Umfang von zwanzig enormen Bänden. Er hat sogar die Kosten für eine solche Publikation kalkuliert. (1o)
2.4.2. Der Kult des Buches schlägt jedoch, wenn man seine Logik weit genug verfolgt, in sein Gegenteil um. Schon bei Queneau stößt das kombinatorische Verfahren an die Grenzen der Buchform. Mit dem dreidimensionalen Text wird sie überschritten. Daraus ergeben sich einige interessante Konsequenzen.
Während nämlich das Buch ein konservierendes Medium ist, dazu bestimmt, Texte festzuhalten, sie zu akkumulieren und zu überliefern, löscht der Poesie-Automat mit jedem neuen Text, den er anzeigt, dessen Vorgänger aus. Aber nicht nur das: da der Zufallsgenerator, der den Automaten steuert, keine Rekonstruktion früherer Zustände zuläßt, ist der einmal gelöschte Text unwiederbringlich verloren. Er verschwindet in der riesigen Menge der möglichen Texte, aus der er nur durch einen extrem unwahrscheinlichen Zufall wieder hervorgeholt werden könnte.
2.4.3. Selbstverständlich könnte man an den Automaten einen Drucker anschließen, der alle ausgeworfenen Texte festhält. Aber auf diese Weise ist der Sache nicht beizukommen. Denn alle diese Texte auszudrucken und festzuhalten wäre auf die Dauer ein Ding der Unmöglichkeit, und selbst wenn man den Versuch unternähme, würde sich das Paradox nur auf einer anderen Ebene wiederholen: das “gesuchte” Gedicht ginge in einem ungeheuren Berg von Drucksachen unter und wäre so gut wie unauffindbar.
2.4.4. Während also bisher die technischen Möglichkeiten der Reproduktion von Texten die Möglichkeiten der Textproduktion übertrafen (was die Voraussetzung dafür ist, daß es Auflagen geben kann, die größer als eins sind), läuft hier die Produktivität der Möglichkeit ihrer Vervielfältigung davon. Ja, es ist vielleicht überhaupt nicht mehr sinnvoll, zwischen dem einen und dem andern zu unterscheiden. Jedenfalls sabotiert der Automat die Möglichkeit, die Texte, die er liefert, zu archivieren, sie in Waren zu verwandeln und in Besitz zu nehmen.
2.4.5. Auch die Frage nach dem Autor der Gedichte zieht merkwürdige Antworten nach sich. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für die Texte, die der Automat erzeugt, wenn weder der Verfasser des Programms noch der Benutzer in der Lage ist, ihren “Inhalt” vorherzusehen? Es liegt nahe, auf eine Redewendung zurückzugreifen, die sich in der deutschen Philosophie lange Zeit großer Beliebtheit erfreut hat: Es sei die Sprache selbst, die (“durch” den Poeten hindurch”) dichte. Das ist aber leider keine Erklärung, sondern eine Mystifikation.
Klar ist nur, daß im genetischen Sinn der Verfasser des Programms als Urheber gelten muß, da ohne seine Arbeit keiner der fraglichen Texte zustande käme. Er ist es auch, der über das Lexikon des Automaten, sein kombinatorisches Gerüst usw. entscheidet. Doch bleiben diese Vorentscheidungen abstrakt; sie konkretisieren sich jeweils nur im einzelnen manifesten Text. Dann ist es aber zu spät. Der Verfasser des Programms kann das Resultat nicht kontrollieren; er weiß nicht, was bei seinem Spiel herauskommt.
2.4.6. Andererseits könnte man behaupten, es sei der Benutzer, der hier “dichte”; denn erst durch seine Intervention treten die jeweiligen Texte hervor. Seine Mitwirkung ist punktuell und minimal, aber notwendig, wie die des Spielers beim Würfelwurf. (Der Schatten Mallarmés fällt also nicht nur auf den Programmierer, sondern auch auf den, der den Knopf drückt.)
Solche Situationen werden von den meisten Menschen, bewußt oder unbewußt, in einem atavistischen Sinn gedeutet. Der Spieler sagt: “Das ist mein Wurf”, oder “Ich habe Glück gehabt”.” Er bringt also seine Person ins Spiel. Dem stochastischen Prozeß unterlegt er eine subjektive Bedeutung. Damit verhält er sich ähnlich wie ein Astrologe, der den Bahnen der Himmelskörper einen menschlichen Sinn beimißt. Es ist übrigens bemerkenswert, daß die Kombinatorik bei der Erstellung von Horoskopen eine wesentliche Rolle spielt. Nun kann man natürlich den Rationalisten hervorkehren und das Verhalten von Sterndeutern und Spielern (warum nicht auch von Lesern?) als Aberglauben bezeichnen — oder als Projektion, wenn man sich auf die Psychoanalyse versteift.
Aber das alles führt in unserm Fall nicht weiter. Jeder Prozeß, der sich der Kontrolle des Betrachters entzieht, bedarf nämlich der subjektiven Deutung; andernfalls bleibt er gleichgültig. Das ist der rationale Kern jener Theorien, auf die sich Spieler, Sterndeuter und Leser berufen. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Interpretationen “falsch” oder “richtig” sind. Das gilt in besonderem Maße für die Lektüre, die ohne die deutende Beteiligung des Lesers, wenn man will, ohne seine Projektionen, gar nicht möglich wäre. Insofern verhält sich die Strategie des Lesers (innerhalb gewisser Grenzen) spiegelbildlich zu der des Autors.
2.4.6. Der Poesie-Automat legt diesen Zusammenhang bloß, indem er die Autorschaft im herkömmlichen Sinn relativiert. Daraus folgt zwar nicht, daß jedermann dichten kann”, und es wäre zuviel verlangt, wollte man sich von einem Automaten die einst vielbeschworene Demokratisierung der Kunst erwarten. Dennoch wird sich von dem Projekt, mit den Worten Benjamins, sagen lassen: “Damit ist die Unterscheidung von Autor und Publikum im Begriff, ihren grundsätzlichen Charakter zu verlieren.” (11) Zumindest aber verspricht der Poesie-Automat ein anonymes, und das heißt, ein namenloses Vergnügen.
3. Weiterungen
3.1. Grenzen des Programms
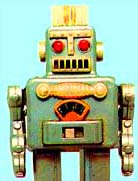 3.1.1. Der hier entworfene Automat erweitert die bisher bekannten Möglichkeiten der programmierten Poesie um eine ganze Dimension. Er weckt jedoch zugleich Wünsche, die er nicht einlösen kann. Wo liegen seine Beschränkungen, und welche Vorgaben wären nötig, um seine Kapazität zu erweitern?
3.1.1. Der hier entworfene Automat erweitert die bisher bekannten Möglichkeiten der programmierten Poesie um eine ganze Dimension. Er weckt jedoch zugleich Wünsche, die er nicht einlösen kann. Wo liegen seine Beschränkungen, und welche Vorgaben wären nötig, um seine Kapazität zu erweitern?
Wer solche Ambitionen zu dämpfen suchte, der könnte behaupten — und dieser Standpunkt wird von vielen vertreten -, jeder Automat, wie differenziert auch immer, sei borniert. Dieser Einwand ist triftig, aber auch trivial, denn er könnte auch in Bezug auf das zentrale Nervensystem der höheren Tiere erhoben werden. Doch stecken auch im bescheidensten Entwurf noch ungenutzte Reserven.
3.1.2. Drei strukturell bedingte Schranken des vorgestellten Automaten verdienen eine nähere Erläuterung.
Zum einen wird die Reichweite des Programms durch die Vorschrift, daß alle Textglieder miteinander kompatibel sein müssen, stark eingeschränkt. Diese Regel ist prinzipiell nicht zu durchbrechen. Doch macht das kombinatorische Gerüst es erforderlich, daß für jede seiner Leerstellen genau n (im vorliegenden Fall also 1o) Elemente zur Verfügung stehen, nicht mehr und nicht weniger. Nun versteht es sich aber von selbst, daß jede natürliche Sprache über ein weit größeres lexikalisches Repertoire verfügt — nur daß die Textglieder, die sich daraus bilden lassen, nicht beliebig miteinander kombinierbar sind. Oft wäre es ein Kinderspiel, statt zehn Elementen deren Dutzende oder Hunderte einzubringen. Eine viel größere Vielfalt wäre die Folge. In anderen Fällen ist dagegen nicht einmal das Minimum n = 1o erreichbar. Wenn sich ein Weg fände, das starre Programmschema zu modifizieren, die Kompatibilitätsregel zu durchbrechen und diese Durchbrechungen ihrerseits zu programmieren, so ließe sich die sprachliche Reichweite des Automaten bis zu einem phantastischen Grad steigern. Dieser Gesichtspunkt ist vor allem für den Poeten als Programmierer von Interesse.
3.1.3. Ein weiterer struktureller Defekt des Automaten liegt darin, daß er mit einem fertigen Programm arbeitet, das, einmal abgeschlossen, keine Erweiterungen mehr zuläßt. Er ist in diesem Sinn unbelehrbar. Der heuristische Wert einer solchen Maschine (die außerdem keinen systematischen Zugriff, sondern nur Random-Lösungen zuläßt) ist dadurch sehr begrenzt. Ein Linguist könnte vermutlich nicht viel damit anfangen. Ein Automat mit offenem Programm würde dagegen allerhand interessante Experimente erlauben. Er wäre, die entsprechende Rechen- und Speicherkapazität vorausgesetzt, lernfähig in dem Sinn, daß sich sein syntaktisches und semantisches Regelsystem immer weiter verfeinern ließe.
3.1.4. Vom Standpunkt des Benutzers aus erscheint als größter Nachteil de Automaten die Bequemlichkeit, mit der er zu bedienen ist. Die Kehrseite dieses Komforts ist es, daß der Eingriff dessen, der mit ihm umgeht, auf ein Minimum beschränkt bleibt. Ein Knopfdruck — das ist alles. Amüsanter wäre es, wenn der Benutzer den Automaten mit seinem eigenen Lexikon füttern könnte, um auszuprobieren, was dieser damit anfängt. Im Prinzip ließe sich ein dialogfähiger Poesie-Automat denken, vielleicht sogar konstruieren.
3.2. Technische Aussichten
3.2.1. Die technischen Anforderungen, die das vorgeschlagene Programm an Hard- und Software stellt, sind sehr bescheiden. Die Textmenge liegt bei 6 KB. Dafür genügt ein winziger Speicher. Die Anzeigetafel wird elektromechanisch gesteuert.
Ein einfacher Computer mit einer Speicherkapazität von einigen Mega- oder gar Gigabyte könnte selbstverständlich viel mehr leisten. Die Schwierigkeit läge einzig und allein im Programm, das eine ganze Hierarchie von syntaktischen und von Lexikonregeln umfassen müßte, einschließlich der Einschränkungen und der Ausnahmen, denen sie unterliegen. Logische Verzweigungen, bedingte Sprungbefehle und Schleifen könnten dann für eine Flexibilität sorgen, die innerhalb einer starren kombinatorischen Struktur unerreichbar ist. An die Stelle der Anzeigetafel müßte dann ein Monitor treten, auf dem jedes Textglied prinzipiell an jeder beliebigen Stelle erscheinen könnte.
3.2.2. Ein solches Projekt liegt jetzt schon in Reichweite. Es müßte an die Erfolge und Fehlschläge anknüpfen, die sich auf dem Feld der automatischen Übersetzung gezeigt haben. Poesie-Automaten höherer Stufe übersteigen die Möglichkeiten eines einzelnen Autors. Sie wären nur von einem Team zu verwirklichen, in dem Linguisten, Programmierer und Poeten zusammenarbeiten. Nicht nur die Figur des Dichters, sondern auch die seines Schattens, des Erfinders und Programm-Autors, der diese Zeilen schreibt, verlöre sich so, wie Dädalus, in seinem eigenen Labyrinth.
3.3. Einladung an poetische Programmierer
3.3.1. Bis dahin ist der Weg noch ziemlich weit. Unterdessen aber ist er frei für jeden, der Lust hat, ihn einzuschlagen. Schon das Programm der dritten Dimension braucht nicht die Marotte eines einzelnen zu bleiben. Die Kapazität des Automaten reicht aus, um viele weitere Entwürfe aufzunehmen. Vorschläge sind willkommen. Amateure seien jedoch gewarnt. Wer ein solches Programm im eigenen Kopf ausarbeiten will, sollte mit ein paar Monaten Arbeitszeit rechnen und sich mit einem Vorrat an Aspirin versehen. Es handelt sich um ein verdammt komplexes Spiel jenseits der Berechenbarkeit.
3.3.2. Die Einladung gilt nicht nur für deutsche Teilnehmer. Der Automat könnte sich zu einem babylonischen Gerät entwickeln, wenn Autoren aus anderen Sprachen bereit wären, weitere Programme beizusteuern. Aus den angedeuteten Gründen wäre das Englische ein besonders geeignetes Medium, aber auch jedes andere Idiom, das sich lateinisch transkribieren läßt, käme in Betracht.
Poesie-Programmierer aller Länder, vereinigt euch!
4. Technischer Anhang
4.1. Anzeigetafel
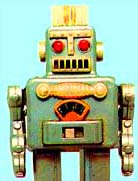 Die Anzeigetafel das Automaten, eine sogenanntes Flap-Board-System, wurde im Winter 1999/2ooo von der Firma Solari S.A. in Udine gebaut. Sie besteht aus sechs Zeilen zu je 142 Einzelelementen (Flap Units).
Die Anzeigetafel das Automaten, eine sogenanntes Flap-Board-System, wurde im Winter 1999/2ooo von der Firma Solari S.A. in Udine gebaut. Sie besteht aus sechs Zeilen zu je 142 Einzelelementen (Flap Units).
Jedes dieser Elemente enthält vierzig Einzelpaletten aus verwindungsfreiem und abriebfestem Kunststoff, die in Lochscheiben waagrecht eingehängt sind und nach vorwärts fallen. Die Palettenrollen hängen ihrerseits in einem Halbzylinder aus Aluminium und von je zwei seitlichen Sinterlagern gehalten. Angetrieben werden die Elemente einzeln über ein geräuscharmes Getriebe durch einen polarisierten Schrittmotor, der seitlich am Palettensystem angebracht ist. Die Schrittgeschwindigkeit liegt bei 75 ms. Die maximale Zeit für eine Umdrehung beträgt somit etwa 2,8 Sekunden.Jeder Einzelschritt des Elektromotors wird durch einen Impuls an die Steuerung quittiert.
Die Zeilen zur Aufnahme der Einzelelemente bestehen aus Aluminium-Profilschienen mit Steckbuchsen für den elektrischen Anschluß. In diese Profilschienen können die Elemente ohne Werkzeug eingesteckt werden. Dadurch können die Zeilen jederzeit neu aufgeteilt und bestückt werden.
Die Palettenzeilen sind übereinander montiert und an seitlichen Kastenprofilen befestigt. Diese Profile enthalten auch die Verdrahtung, die durch Blechstreifen abgedeckt und jederzeit von vorne zugänglich ist. Für jede Zeile ist eine Kabelsteckverbindung vorgesehen, so daß im Bedarfsfall komplette Zeile ausgetauscht und die ganze Tafel um weitere Zeilen verlängert werden kann.
Jedes Palettenelement kann einen Satz von vierzig alphanumerischen Zeichen (einschließlich Satzzeichen und Spatium) aufnehmen. Zur Beschriftung werden reflektierende Farben im Seidendruckverfahren verwendet. Das erhöht die Lesbarkeit, auch bei Sonneneinstrahlung oder Gegenlicht. Bei einer Schrifthöhe von 35 mm sind die Anzeigen bis auf eine Entfernung von 15-2o Metern gut lesbar. Der horizontale Lesbarkeitswinkel liegt bei 17o°.
Als Schriftschnitt wurden die Versalien einer halbfetten Akzidenz-Groteske vom Typ der Helvetica gewählt, die weiß auf schwarzem Grund erscheinen.
Die Anzeigetafel mißt 565o x 1ooo x 2oo mm und wiegt 66o kg. Sie wird über eine Schnittstelle vom Typ DSK (LAN Ethernet) angesteuert.
Nach Angaben des Herstellers befinden sich mehrere hunderttausend derartige Systeme im Einsatz, vor allem auf Flughäfen und Bahnhöfen, in Banken und Börsen. Zu ihrer Betriebssicherheit wird gesagt, daß die mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen, bei ununterbrochenem Lauf und 1,6 x 1o6 Umdrehungen, 18oo Stunden beträgt; bei normalem Betrieb, d.h. bei je einer Umdrehung in fünf Minuten, fällt das System, statistisch gesehen, nur alle zehn Jahre aus. Seine theoretische Lebenserwartung liegt bei 5o Jahren.
4.2. Software
Die zur Steuerung des Anzeigetafel erforderliche Software wurde von der Firma Galilei GmbH in Oberhaching entwickelt. Zugrunde liegen ihr einerseits das Textprogramm des Autors (die “Quelldatei”), andererseits die Spezifikationen der Firma Solari. Die Eingabedaten wurden dem Konzept entsprechend strukturiert, als Textdatei digitalisiert und auf der Festplatte eines Rechners gespeichert. Der Zugriff auf die Datei wird durch einen Zufallsgenerator gesteuert. Die generierten Verse können auch auf einem Bildschirm angezeigt werden.
Das von Galilei entwickelte Programm wurde auf Borland Delphi 4.o für Win32-Umgebung geschrieben. Die Systemvoraussetzungen für dieses Programm sind: Windows 9x/NT/2ooo; mindestens Pentium 1oo und 16MB RAM; 1 MB HDD Speicherplatz für Quelldatei und Gedicht-Zwischenspeicher. Für die Bildschirmanzeige wird ein Farbmonitor mit 8oox6oox75Hz HiColor empfohlen.
Die Quelldatei enthält die Poesie-Elemente. Sie ist folgendermaßen strukturiert, wenn
m = Anzahl der Gedichtzeilen
n = Anzahl der Elemente pro Zeile
k = Anzahl der Varianten pro Element und Zeile:
Element 1 Variante 1 Zeile 1 Element 2 Variante 1 Zeile 1... Element n Variante 1 Zeile 1
Element 1 Variante 2 Zeile 1 Element 2 Variante 2 Zeile 1... Element n Variante 2 Zeile 1
............
Element 1 Variante k Zeile 1 Element 2 Variante k Zeile 1... Element n Variante k Zeile 1
Element 1 Variante 1 Zeile 2 Element 2 Variante 1 Zeile 2... Element n Variante 1 Zeile 2
Element 1 Variante 2 Zeile 2 Element 2 Variante 2 Zeile 2... Element n Variante 2 Zeile 2
............
Element 1 Variante k Zeile 2 Element 2 Variante k Zeile 2... Element n Variante k Zeile 2
............
Element 1 Variante 1 Zeile m Element 2 Variante 1 Zeile m...Element n Variante 1 Zeile m
Element 1 Variante 2 Zeile m Element 2 Variante 2 Zeile m...Element n Variante 2 Zeile m
...........
Element 1 Variante k Zeile m Element 2 Variante k Zeile m...Element n Variante k Zeile m
Diese Struktur erzeugt Gedichte mit m Zeilen, bei n Elementen pro Zeile und k Varianten pro Element. Der Algorithmus sieht folgendermaßen aus:
Erzeuge eine Zufallszahl r1 (zwischen 1 und k);
drucke Element 1 für Zeile 1 in der Variante r1 aus;
erzeuge eine Zufallszahl r2 (zwischen 1 und k);
drucke Element 2 für Zeile 1 in der Variante r2 aus;
...
erzeuge eine Zufallszahl rn (zwischen 1 und k);
drucke Element n für Zeile 1 in der Variante rn aus;
schalte zur folgenden Zeile um; usw.
Die Quelldatei kann nach diesem Prinzip — nur durch die Vorgaben der Anzeigetafel begrenzt — beliebig ausgetauscht oder erweitert werden. Auch komplexere Software-Programme zur Steuerung des Automaten sind denkbar, vorausgesetzt, es stehen entsprechend formalisierte syntaktische, semantische und kontextabhängige Regeln zur Verfügung.
|
